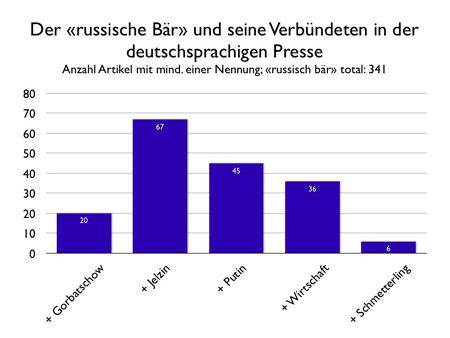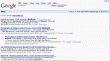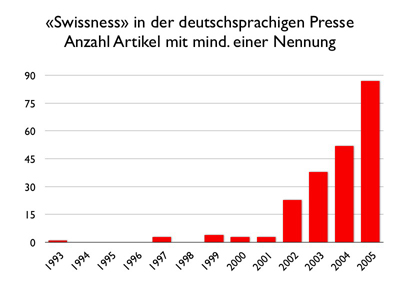Ich wartete in der Bäckerei drauf, bedient zu werden. Bevor sich die Verkäuferin mir zuwandte, rief sie der gerade gehenden Kundin zu: „Die Schwelle!“
Ich überlegte: Nein, die Schwelle war nicht besonders hoch, dass Gefahr wäre, darüberzustolpern. Es war auch nicht so, dass man um seinen Kopf hätte fürchten müssen, den man allenfalls wegen der Schwelle unten am Türrahmen oben anschlagen hätte können. Es gab auch keine jäh in die Tiefe führende Treppe, die man, sich auf die Schwelle konzentrierend, herunterfallen könnte. Nein, ich war ratlos, was „die Schwelle“ in diesem Moment bedeutete und gab jegliche Interpretationsversuche auf und richtete meine Aufmerksamkeit stattdessen auf die Wahl des Brotes.
Ich schreibe an dieser Stelle jetzt aber nicht darüber, dass es mir ein Rätsel ist, weshalb das Brot, das ich kaufen wollte, „Wurzelbrot“ heisst. Nur einen kurzen Moment studierte ich darüber nach, ob da wohl statt Roggen und Weizen Wurzelmehl im Spiel war und was für eine Art Wurzel es sein könnte – ich gab das Nachdenken darüber sofort auf, war mir der Besuch in dieser Bäckerei doch schon genug rätselhaft.
Doch kam die Erleuchtung Sekunden später: Ich bezahlte, packte das Brot unter den Arm und wollte den Laden verlassen. Irritiert blieb ich vor der Schiebetüre stehen, die sich nicht öffnen wollte. Da hörte ich von hinten: „Die Schwelle!“ Und siehe da: Das Wort machte plötzlich Sinn! Die Schwelle war dieser mit einem schwarzen Plastikbelag überdeckte Bereich, der auf Druck reagiert und Schiebetüren öffnen lässt. Dieser Bereich war aber nur gerade 20 cm tief – also in der Form und Grösse einer Schwelle. Und man muss darauf treten, damit sich die Türe öffnet…
Die Verkäuferin sagte exakt dasselbe wie vorher zur Kundin. Das erste Mal verstand ich Bahnhof, das zweite Mal war die Bedeutung sofort klar. Jaja, es gibt schon Gründe, weshalb nicht nur Wittgenstein darauf beharrt, dass die Bedeutung von Wörtern in ihrem Gebrauch in einem bestimmten Kontext entsteht. Ohne Kontext sind Wörter nackt und ohne sprachlichen Wert.
Aber warum das Wurzelbrot Wurzelbrot heisst, weiss ich noch immer nicht.