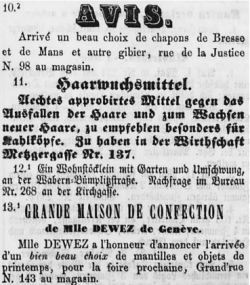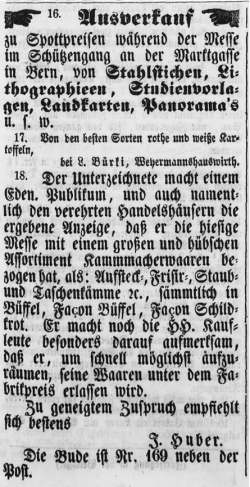Die letzte Sprechtäkeli-Schau förderte ja sehr explosive linguistische Bomben zutage. Die heutige Rückschau ist friedlicher:
- Nils befürchtet im GoetheBlog, bald nur noch automatisch generierte Geburtstagsnachrichten zu erhalten. Auch ich machte die Erfahrung, dass die Deutsche Bahn keine Mühen scheut, und pünktlich zum Geburtstag eine E-Mail versendet. Doch das ist nicht alles. Denn darin steht:
[…] zum Geburtstag möchten wir dazu beitragen, dass sich all Ihre Wünsche im neuen Lebensjahr erfüllen.
Aus diesem Grund schenken wir Ihnen heute 100 bahn.bonus-Punkte, die Sie Ihrer Wunschprämie ein gutes Stück näher bringen. Diese schreiben wir Ihnen automatisch auf Ihrem persönlichen bahn.bonus-Konto gut.
Übrigens, wir haben noch eine weitere Überraschung für Sie vorbereitet.
Klicken Sie einfach hier: www.geburtstagspunkte.de
Sie haben jetzt also die einmalige Gelegenheit, so zu tun, als ob sie Geburtstag hätten! Ein Klick, und die Bahn singt für sie! (Ok, die Bonus-Punkte – ähm, nein: bahn.bonus-Punkte müssen Sie sich selber verdienen.)
- Der geschätzte Kollege Jean Véronis outet sich als waschechter empirischer Linguist. Es ist nämlich so: Wir Linguistinnen und Linguisten sind strikt gegen Mobiltelefonverbote in Zügen, Flugzeugen, Kinos und Restaurants. Denn das Datenmaterial, dass sich ergibt, wenn man scheinbar teilnahmslos aus dem Fenster blickend nichts anders macht, als angestrengt den Telefongesprächen der Mitmenschen zu lauschen, ist fantastisch. Kosenamen, Begrüssungs- und Verabschiedungsformeln („Aso denn tschüssli bäbäi!“), effektvolle Hörerbindungsmassnahmen („Aso jetzt muni dir mol öppis ganz im Vertraue säge…“), Modi des Lästerns – was immer Sie für Ihren nächsten Aufsatz benötigen, es reichte für vier Dissertationen.
Und Jean Véronis erzählt von der netten Dame im Mobilfunkverbot-Wagen des TGVs und ihrer wunderbaren Schlussformel: „Allez, va, ça ira!“ Was man mit zwei Wörtern – darunter „aller“ in drei Formen – sagen kann!
- Der linguistische Monarch und das Wortistik-Blog sind sich nicht ganz einig darüber, ob die Neuschöpfung des Verbs „fünfzigen“ eine Bieridee ist oder eine gelungene Möglichkeit, aus dem Schicksalschlag des 50-werdens einen Freudentag zu machen. Ich muss zugeben, dass ich Neologismen aller Art besonders mag. Und damit bin ich auch Fan der Wortwarte des Computerlinguisten Lothar Lemnitzer. Automatisch werden dort Wortneuschöpfungen der deutschen Presse eruiert. Die neuen Wörter vom 31. Oktober 2006 waren:
Backwaschundbügeltag, der
Geburtenratenhysterie, die
Kreditnehmerplattform, die
Kreditportal, das
Mikrogenerator, der
Navigationshandy, das
Quotenhandel, der
Schizografie, die
Sloganzing, das
Spaßzone, die
Standortnetz, das
Videowerbeform, die
Weichpianist, der
Wettportal, das
Wissenskredit, derMan muss sich schon klar sein: Ein Bachwaschundbügeltag ohne angemessenen Wissenkredit und eingerichteter Spasszone mit Weichpianisten geht so in die Hose, dass Sie sofort schizograf werden. Jawoll, so ist das!

 Nehmen wir doch so etwas naheliegendes wie Pasta. Es versteht sich von selbst, dass gewisse Pastasorten selber hergestellt werden müssen. Zwar auch in Italien keine Tugend mehr, die in allen Haushalten gelebt wird.
Nehmen wir doch so etwas naheliegendes wie Pasta. Es versteht sich von selbst, dass gewisse Pastasorten selber hergestellt werden müssen. Zwar auch in Italien keine Tugend mehr, die in allen Haushalten gelebt wird.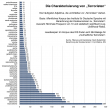
 Das ist also die Zeit, in der das Zürcher Oberland an den Wochenenden jeweils „Schönwetteralarm“ (
Das ist also die Zeit, in der das Zürcher Oberland an den Wochenenden jeweils „Schönwetteralarm“ (
 Wir wollen hier regelmässig einen Blick auf die täglichen Sprechtäkeli der Blogosphäre werfen: Eine Ikone ist
Wir wollen hier regelmässig einen Blick auf die täglichen Sprechtäkeli der Blogosphäre werfen: Eine Ikone ist 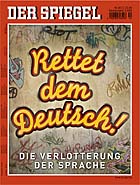 Damit zeigt sich sehr wörtlich, dass
Damit zeigt sich sehr wörtlich, dass