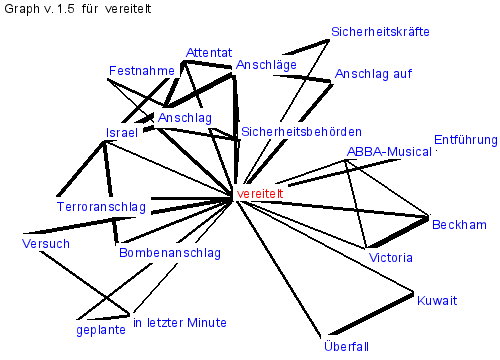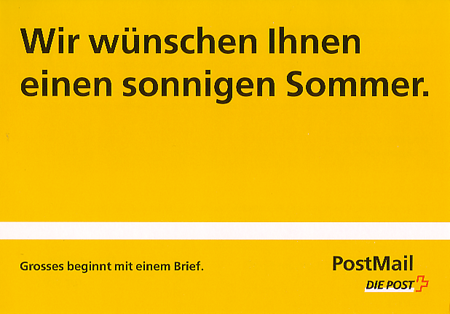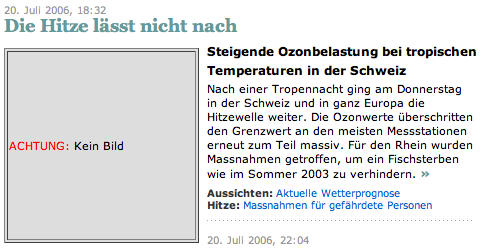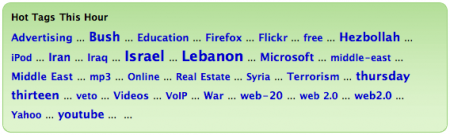Betrug ist, wenn das, was versprochen, nicht gehalten wird. Das dachten sich enttäusche Leserinnen und Leser des Buches „A Million Little Pieces“ von James Frey. Der Bestseller des Jahres 2005 in den USA erzählt die Geschichte eines geläuterten Drogensüchtigen. Die Leserinnen und Leser waren nicht enttäuscht über die Geschichte; die stiess auf Anklang. Doch zeigten sie sich über den Umstand empört, dass Verlag und Autor die Geschichte als „Memoiren“ verkauften, im Nachhinein jedoch das Online-Magazin „The Smoking Gun“ aufzeigte, dass darin vieles erstunken und erlogen ist.
Betrug ist, wenn das, was versprochen, nicht gehalten wird. Das dachten sich enttäusche Leserinnen und Leser des Buches „A Million Little Pieces“ von James Frey. Der Bestseller des Jahres 2005 in den USA erzählt die Geschichte eines geläuterten Drogensüchtigen. Die Leserinnen und Leser waren nicht enttäuscht über die Geschichte; die stiess auf Anklang. Doch zeigten sie sich über den Umstand empört, dass Verlag und Autor die Geschichte als „Memoiren“ verkauften, im Nachhinein jedoch das Online-Magazin „The Smoking Gun“ aufzeigte, dass darin vieles erstunken und erlogen ist.
Betrug! Es kam zur Klage gegen Autor und Verlag. Das Gericht entschied (NZZ vom 15. 9. 2006, S. 43), dass jene, die das Buch vor dem Enthüllungdatum im Glauben gekauft hatten, es handle sich um einen Tatsachenbericht, Anspruch auf Geldrückgabe haben.
Manchmal wird Sprache doch etwas zu wörtlich genommen. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber es war eine meiner ersten und trivialeren Lektüreerkenntnisse, dass das „Ich“ im Buch nicht immer dem „Ich“ des Autors oder der Autorin entspricht – geschweige, dass dieses Ich nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagt. Und „Erinnerungen“, „Tagebücher“ und „Memoiren“ erzählen auch selten nur von ihr – lesen Sie einfach mal wieder ihre alten Tagebücher und Sie sehen, was ich meine.
Und trotzdem ist es natürlich von Reiz, mit den passenden Worten Wirkungen zu erzeugen, die man im Nachhinein als unbeabsichtigt darstellen kann. Wie das geht, diskutierten wir ja bereits. Doch manchmal kann das auch gefährlich werden, wie die Folgen einer Papst-Rede aktuell zeigt. Es wäre eigentlich praktisch, wenn man sich in dieser Sache der gleichen Methode bedienen könnte wie im Frey-Fall: Klage, Entschuldigung, gerichtlicher Vergleich: Joseph Ratzinger schreibe doch bitte 10 Mal an die Tafel: „Es tut mir leid, den Islam beleidigt zu haben. Es war nicht meine Absicht. Ich gelobe Besserung.“ Oder so ähnlich. Doch ob das dann auch so wörtlich genommen würde?